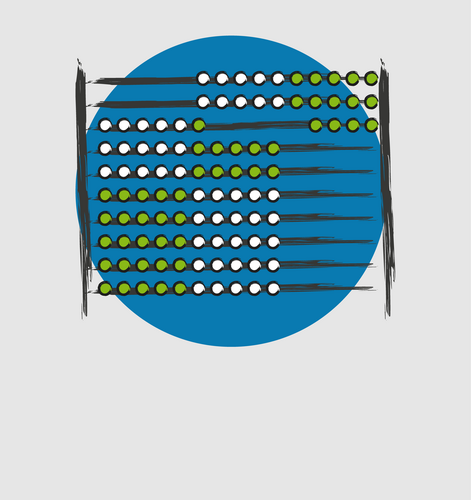Wir freuen uns, folgende Hauptvortragende ankündigen zu dürfen:
Dr. Fiene Bredow
Universität Bremen

Die Rolle von Lehrkräften beim mathematischen Argumentieren im Unterricht: Eine interpretative Perspektive
Mathematisches Argumentieren ist konstitutiv für das Lernen von Mathematik, so die Annahme interpretativer Unterrichtsforschung. Empirische Forschungsergebnisse zeigen, dass Lehrkräfte im Mathematikunterricht entscheidend dazu beitragen, ob mathematische Argumentationen entstehen und wie sie gelingen. Interpretative Unterrichtsforschung bietet einen wertvollen methodologischen Ansatz, um interaktiv und epistemologisch zu rekonstruieren, wie Lehrkräfte beim mathematischen Argumentieren im Unterricht handeln und ihre Schüler*innen damit beim Lernen von Mathematik unterstützen.
In diesem Vortrag wird aus Perspektive der interpretativen Unterrichtsforschung gezeigt, wie (unterstützende) Lehrkrafthandlungen im Unterrichtsalltag aussehen. Dabei zeigt sich, dass diese Lehrkrafthandlungen sowohl konstruktiv als auch „derangierend“ und somit hinderlich für die mathematischen Argumentationsprozesse im Unterricht sein können.
Zur Person: Fiene Bredow forscht zum mathematischen Argumentieren und Beweisen im Kontext empirischer Unterrichtsforschung. Ein zentrales Interesse gilt dabei der Rolle der Lehrkraft. Weitere Forschungsschwerpunkte sind die Didaktik der Algebra sowie international vergleichende Perspektiven. Seit ihrer Promotion 2023 ist Fiene Bredow Postdoktorandin an der Universität Bremen. Sie ist u.a. Co-Leitung der Arbeitsgruppe „Argumentation and Proof“ der European Society for Research in Mathematics Education (ERME).
Prof. Dr. Karine Chemla
University of Edinburgh/CNRS Paris

Warum muss die Geschichte der mathematischen Symbolik neu geschrieben werden?
[Why should we rewrite the history of mathematical symbolism?]
Karine Chemla widmet sich in ihrem Vortrag der Geschichte der Zahlensysteme mit einem besonderen Fokus auf das positionale Dezimalsystem. Ausgehend von langjährigen Studien zur chinesischen Mathematik wird die These vertreten, dass sich das Dezimalsystem von Natur aus grundlegend von anderen Zahlensystemen unterscheidet. Dabei wird aufgezeigt, inwiefern die Entwicklung dieses Systems untrennbar mit der Geschichte der mathematischen Symbolik verbunden ist. Diese Perspektive eröffnet nicht nur neue Einsichten in die historische Dimension des Mathematikunterrichts, sondern wirft zugleich eine Reihe von für die Didaktik zentrale Fragen auf.
Hinweis: Der Vortrag ist der Kategorie „International“ zugeordnet und wird von Frau Chemla auf Englisch gehalten.
Zur Person: Karine Chemla ist Mathematikhistorikerin mit Schwerpunkt auf der Mathematikgeschichte Chinas. Sie forscht am CNRS in Paris und ist Professor an der Universität Edinburgh. Sie war Gastprofessorin an Universitäten in China sowie am MPI für Wissenschaftsgeschichte Berlin. 2020 wurde sie mit dem Otto-Neugebauer-Preis der European Mathematical Society ausgezeichnet. Ihre Analysen chinesischer mathematischer Lehrbücher und Kommentare, darunter die Neun Bücher mathematischer Prozeduren, bieten wertvolle Einblicke in die historische Wissensvermittlung.
Prof. Dr. Andreas Dengel
Goethe-Universität Frankfurt am Main

Die eierlegende Wollmilch-KI: Bildung über, mit und trotz Künstlicher Intelligenz
"Als ein künstliches Sprachmodell kann ich keine Aussagen über die Zukunft der Bildung treffen..." sagt uns ChatGPT, gibt uns aber viele Vorschläge, wie Künstliche Intelligenz in der Bildung integriert werden kann. Aber welche Rolle übernimmt die Lehrperson der Zukunft in ihren Aufgabenbereichen Unterrichten, Erziehen, Beurteilen, Beraten und Innovieren? Der Ansatz der Augmented Intelligence bezeichnet die Zusammenarbeit von künstlicher und menschlicher Intelligenz und somit die Kombination maschineller, datengetriebener Entscheidungen mit unserem eigenen Urteilsvermögen. So wird aus der Befürchtung des frontal unterrichtenden KI-Roboterlehrers ein „Unterstützer des Unterstützers": Automatisierbare Aufgaben werden ausgelagert, um mehr Raum für pädagogisches Handeln im Unterricht zu schaffen. Künstliche Intelligenz wird so zu einer einflussreichen, aber nicht allmächtigen Bildungstechnologie in der didaktischen Werkzeugkiste der Lehrpersonen.
Zur Person: Andreas Dengel ist Professor für Didaktik der Informatik und Studiendekan der Informatik an der Goethe-Universität Frankfurt. Nach seinem Lehramtsstudium (Informatik/Wirtschaft) arbeitete er als Wissenschaftlicher Mitarbeiter in Passau und Würzburg und promovierte zu Virtual Reality im Informatikunterricht. Seit 2021 leitet er die Professur in Frankfurt und das ECSE Lab, ein „Klassenraum der Zukunft“. Seine Forschungsschwerpunkte sind Immersives Lernen mit VR/AR, Computer Science Unplugged und KI-Didaktik. Er erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter die Forbes 30Under30, und leitet das IEEE TC-ILE.
Prof. Dr. Friedhelm Käpnick
Universität Münster

„Das hat mich sehr erstaunt!“ – Impulsgebende Resultate der Begabungsforschung für die Breitenförderung im Mathematikunterricht
Im deutschsprachigen Raum haben sich bisher nur sehr wenige Mathematikdidaktiker:innen intensiv, längerfristig und systematisch dem Themenkomplex „Mathematische Begabungen“ gewidmet. Die diesbezügliche fachdidaktische Forschung erbrachte dennoch sehr vielfältige wissenschaftlich fundierte wie auch schulpraktisch relevante Erkenntnisse, die nicht nur Basis für eine nachhaltige Begabungsförderung sind, sondern zugleich die (Weiter-)Entwicklung von Konzepten für die Breitenförderung im Mathematikunterricht auf verschiedenen Ebenen bereichern – insbesondere im Kontext Inklusiver Bildung. Das gilt in analoger Weise ebenso für eine effizientere Lehrpersonenaus- und -fortbildung. Im Vortrag werden hierfür einige solche Konzeptbausteine herausgestellt und an konkreten Beispielen zum regulären Mathematikunterricht sowie zur fachlichen und fachdidaktischen Lehrpersonenausbildung erläutert.
Zur Person: Friedhelm Käpnick arbeitete nach seinem Lehramtsstudium vier Jahre als Lehrer, promovierte 1990 und habilitierte sich 1998 in Mathematikdidaktik. Nach Vertretungsprofessuren wurde er 1999 Professor an der TU Braunschweig und leitete von 2004 bis 2021 den Lehrstuhl für Mathematikdidaktik an der Universität Münster, wo er weiterhin als Seniorprofessor tätig ist. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Förderung mathematisch begabter Kinder und die Entwicklung von Lehr-Lern-Materialien.
Prof. Dr. Ysette Weiss
Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Blinde Flecken einer wiedervereinigten Mathematikdidaktik
Bildungsreformen sind besonders interessante Momente in der Bildungsgeschichte, da Bildungsziele formuliert, Bildungsideale und pädagogische Paradigmen erläutert werden und zugleich ein kritischer Blick in die Vergangenheit geworfen wird, um Reformbemühungen zu begründen. In den 1950er bis 1970er Jahren gab es in vielen westeuropäischen Ländern, den USA und auch in den Ländern des Ostblocks Bestrebungen, die Schulmathematik der Oberstufe zu modernisieren und die wachsende Kluft zur höheren Mathematik zu verringern. Die Untersuchung ost- und westdeutscher Reformbemühungen ist besonders interessant. Die gemeinsame Bildungstradition erlaubt Bezüge und Vergleichbarkeit, gleichzeitig verdeutlichen Unterschiede die Rolle kulturhistorischer, ideologischer und institutioneller Bedingungen. In Ostdeutschland wurde durch den Mathematikbeschluss (1962) praxisnahe Entwicklungsforschung durch die Bildungspolitik verstärkt gefördert und zentral gesteuert. Die westdeutsche Mathematikdidaktik orientierte sich stark an internationalen Entwicklungen, sowie ihrer Institutionalisierung und Etablierung als Wissenschaftsdisziplin. Der Vortrag gibt Einblicke in Ziele und Verläufe der Reformbemühungen in Ost- und Westdeutschland und zeigt deren Bedeutung für das aktuelle Selbstverständnis einer sich als gesamtdeutsch verstehenden Mathematikdidaktik.
Zur Person: Ysette Weiss forscht aus kulturhistorischer Perspektive zu Reformen im deutschsprachigen Mathematikunterricht im 19ten und 20ten Jahrhundert sowie zu Aufgabendidaktik, Schulbuch- und Textanalyse und zu Lernvideos. Sie war an elf Universitäten in fünf Bildungssystemen in Ost- und Westeuropa tätig. Weiss ist u.a. Sprecherin des AK Mathematikgeschichte im Unterricht der GDM und Mitglied des Beirats der International Study Group on the Relations Between the History and Pedagogy of Mathematics (HPM).
Hinweis:
Wir danken Frau Bohlmann herzlich für ihre Bereitschaft, einen Beitrag auf der GDM zu leisten. Leider musste der angekündigte Vortrag aus privaten Gründen zurückgezogen werden. Wir bitten um Verständnis.