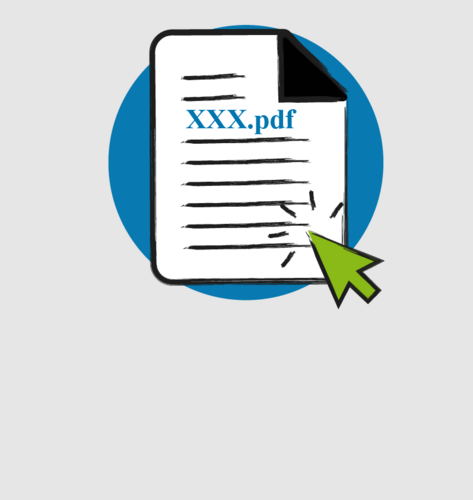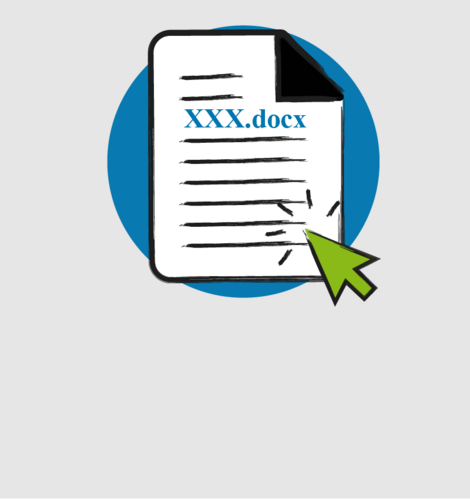Übersicht über die Minisymposien 2026 in Wuppertal
Aus der Vielzahl an Einreichungen wurden insgesamt 21 Minisymposien für die GDM 2026 vom Programmkomitee angenommen. Die Minisymposien finden am Mittwoch, Donnerstag und Freitagvormittag statt. Die Leitungen und Abstracts sind im Folgenden aufgeführt …
Leitung: Matthias Brandl (Passau), Ralf Benölken (Wuppertal), Lukas Donner (Göttingen), Peter Kaiser (Tübingen), Moritz Zehnder (Bayreuth)
Seit etwa Mitte der 1980er Jahre haben sich Forschungsarbeiten zu mathematischen Begabungen als eigenständige Strömung in der deutschen Mathematikdidaktik etabliert. Als Konsens gilt in der Regel eine ganzheitlich-individuelle und domänenspezifisch geprägte Sicht auf das Konstrukt Begabung, das zugleich als dynamisches Phänomen interpretiert wird, nicht als unveränderliche Disposition eines Individuums.
Dieses Minisymposium greift aktuelle Forschungsbemühungen zu mathematischen Begabungen, insbesondere zur Diagnostik und Förderung, in ihrer Breite auf. Diese sind beispielsweise darauf gerichtet, Barrieren zu beseitigen oder Förderkonzepte unter Bedingungen von Digitalität zu entwickeln und zu evaluieren, unter anderem, um für Schüler*innen aus soziokulturell unterprivilegierten Gruppen Partizipation zu gewährleisten. Ein Fokus soll dabei auch auf Mathematikwettbewerben liegen. Begabung wird als breites Themenfeld kontextsensitiv interpretiert und im Spannungsfeld zwischen Begabtenförderung, also einer Förderung im hoch selektierten, kleinen Adressat*innenkreis, und Begabungsförderung, also einer Potenzialentfaltung bei allen Lernenden, wahrgenommen.
Die Beiträge präsentieren eine Vielfalt an Perspektiven, die sowohl empirische, inhaltliche als auch theoretische Überlegungen umfassen. Darüber hinaus soll das Symposium dazu beitragen, fachdidaktisch fundierte Ansätze für die Begabtenförderung im Mathematikunterricht weiterzuentwickeln und den Austausch zwischen verschiedenen an der Förderung beteiligten Akteuren zu ermöglichen. Das Symposium wird auch thematisch affinen Beiträgen offenstehen, etwa Forschungsarbeiten zu mathematischer Kreativität.
Leitung: Lena Radünz (Wuppertal), Thomas Rottmann (Bielefeld)
Das Minisymposium „Mathematik und Bewegung – Potenziale für mathematische Lernprozesse“ widmet sich der Bedeutung körperlicher Bewegung für die Unterstützung mathematischer Lernprozesse – von aktiven Bewegungen des ganzen Körpers durch den Raum bis hin zu feineren Formen wie Gesten, die auf der Reaktivierung motorischer Erfahrungen beruhen. Die Vielfalt der Bedeutungen körperlicher Bewegungen wurde bereits in der internationalen CERME-Themengruppe „Embodied and Material Studies of Mathematical Behaviour“ deutlich. An diese Diskussionen möchte das Minisymposium anknüpfen, indem es u.a. internationale Embodiment-Perspektiven mit deutschsprachigen Traditionen wie dem „Bewegten Lernen“ aus der Sportwissenschaft in Beziehung setzt. Ziel ist es, zentrale Begriffe, theoretische Konzepte und Forschungsansätze zu klären, Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten und so eine Grundlage für einen interdisziplinären Austausch zu schaffen. Darüber hinaus bietet das Minisymposium die Gelegenheit, Ansätze für die praktische Umsetzung im Mathematikunterricht und die damit verbundenen Lernchancen und Herausforderungen aus einer fachdidaktischen Perspektive zu diskutieren.
Das Minisymposium versteht sich zugleich als Vernetzungsraum für die GDM-Community, um das Forschungsfeld im deutschsprachigen Raum sichtbar zu machen, kritisch zu diskutieren und Impulse für weiterführende empirische und theoretische Arbeiten zu geben. So soll das Potenzial von Bewegung für mathematische Lernprozesse systematisch ausgelotet und für zukünftige Forschungsperspektiven fruchtbar gemacht werden.
Leitung: Leander Kempen (Greifswald), Michael Meyer (Köln), Eva Müller-Hill (Rostock), Silke Neuhaus-Eckhardt (Würzburg), Melanie Platz (Saarbrücken)
Argumentieren, Begründen und Beweisen sind zentrale mathematische Tätigkeiten und bilden das Fundament der Mathematik als beweisende Wissenschaft. Die zugehörigen Prozesse sind dabei insbesondere auch für die Schul- und Hochschulmathematik relevant und sollen in diesem Mini-Symposium fokussiert werden.
Wir laden hiermit aktuelle Forschungsstudien sowie Weiterentwicklungen bereits andiskutierter Projekte ein, die Argumentations-, Begründungs- und Beweisprozesse in Schule oder Hochschule thematisieren. Da diese Prozesse ein komplexes Zusammenspiel von spezifischen Kommunikations-, Interaktions- bzw. Denkprozessen aufweisen, freuen wir uns auf eine brandbreite von Forschungsperspektiven, wie beispielsweise soziologische, philosophische oder stoffdidaktische Analysen oder Studien zur Entwicklungsforschung. Dieses Minisymposium soll ein Forum dafür bieten, einen tieferen Einblick in die Prozesse und die zugehörigen Forschungsperspektiven und -methoden zu erhalten sowie mögliche Vernetzungen zu identifizieren und zu diskutieren.
Leitung: Carina Büscher (Köln), Jens Dennhard (Heidelberg), Saskia Schreiter (Schwäbisch Gmünd)
Computational Thinking (CT) umfasst Denkprozesse, die es ermöglichen, Probleme so zu strukturieren und zu lösen, dass digitale Geräte und Algorithmen effektiv eingesetzt werden können. Damit verbindet CT informatische Prinzipien mit zentralen mathematischen Prozessen wie Modellieren, Problemlösen und Argumentieren. Als zentrale Zukunftskompetenz des 21. Jahrhunderts wird CT zunehmend als Bestandteil allgemeiner Bildung verstanden und gewinnt im internationalen Diskurs wie auch in curricularen Entwicklungen stark an Bedeutung.
Die Beiträge im Minisymposium bündeln konkrete Ideen zur Diagnose und Förderung von CT im Mathematikunterricht der Sekundarstufe sowie in der universitären Lehrkräfte(aus)bildung. Diskutiert werden innovative Lehr-Lern- Arrangements, Ansätze zur Verknüpfung von CT mit prozess- und inhaltsbezogenen Kompetenzen sowie empirische Befunde zu Chancen und Herausforderungen bei der Messung von CT im schulischen Kontext. Damit leistet das Minisymposium einen Beitrag zur Weiterentwicklung von Forschung und Praxis im Bereich der Mathematikdidaktik.
Die thematischen Schwerpunkte umfassen unter anderem:
-
Förderung von Computational Thinking im Mathematikunterricht durch gezielte Lehr-Lern-Arrangements
-
Entwicklung und Erprobung von Instrumenten zur Messung von CT- Kompetenzen
-
Empirische Befunde zum Zusammenhang von CT und mathematischen Kompetenzen wie Problemlösen, Modellieren oder Argumentieren
-
Curriculare Ansätze zur Integration von CT in den Mathematikunterricht und die Lehrkräftebildung
Leitung: Karin Binder (Paderborn), Daniel Frischemeier (Münster), Sarah Schönbrodt (Salzburg)
Data Science entwickelt sich zunehmend zu einer Schlüsseldisziplin an der Schnittstelle von Mathematik, Informatik und verschiedenen Anwendungsfeldern – insbesondere auch dem MINT-Bereich. Angesichts der wachsenden Bedeutung von Daten in Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft stellt sich die Frage, wie Data Science langfristig im Bildungswesen verankert werden kann. Dieses Minisymposium greift diese Herausforderung auf und bietet ein Forum zur Diskussion zentraler Wege, Perspektiven und Chancen von Data Science Education – im Mathematikunterricht und in der Hochschulbildung.
Im Fokus stehen Ansätze, wie Data Science nachhaltig in den Mathematikunterricht integriert werden kann, wie statistische Konzepte durch geeignete Visualisierungen zugänglich gemacht werden und wie Lernende durch die Arbeit mit realen und sozialen Kontexten für den kritischen Umgang mit Daten sensibilisiert werden können.
Ein besonderes Anliegen ist die Förderung von Data Literacy als grundlegende Kulturtechnik, die für eine reflektierte Teilhabe in einer datengetriebenen Welt und auch für das Demystifizieren von künstlicher Intelligenz unverzichtbar ist. Data Literacy umfasst nicht nur die Fähigkeit, Daten zu analysieren und zu interpretieren, sondern auch, deren Aussagekraft kritisch zu hinterfragen und alternative Darstellungsformen zu verstehen.
Dieses Minisymposium zu Data Science Education wird unterschiedliche Perspektiven, Konzepte und Best Practices aus Forschung und Praxis zusammenführen und so Impulse für die Weiterentwicklung von Data Science Education geben. Primäres Ziel ist es, innovative Wege aufzuzeigen, wie Schule und Hochschule auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereitet und Lernende zu kompetenten und mündigen Bürger:innen im Umgang mit Daten befähigt werden können.
Leitung: Christina Drüke-Noe (Weingarten), Corinna Hankeln (Dortmund), Katrin Klingbeil (Duisburg-Essen)
Formatives Assessment kann auf qualitative und/ oder quantitative Daten gestützt sein. Es soll diagnostische Informationen liefern und diese lernwirksam nutzbar machen. Digitale Technologien haben das Potential eine solche Lernstandsdiagnostik zu unterstützen, u. a. bei der Bereitstellung von Aufgaben, der Analyse und auch dem (adaptiven) Feedback sowie der Förderung. Um Lernprozesse wirkungsvoll begleiten und Lernen fördern zu können, bedarf es zunächst passgenauer Diagnosen. Hierfür benötigen Lehrende fachliches und fachdidaktisches Wissen, um geeignete Aufgaben zusammenstellen zu können, die Fertigkeiten und auch Verständnis prüfen; zudem bedarf es tragfähiger methodischer alltagstauglicher technischer Konzepte. Die Deutung diagnostischer Informationen und die Ableitung passender Fördermaßnahmen, die jeweils den Ansprüchen an ein adaptives formatives und zudem nutzbares Feedback genügen, bedürfen ebenfalls der Expertise der Lehrenden. Damit Lernende solches Feedback nutzen können, muss es fokussiert und darf nicht zu komplex gestaltet sein.
In Anknüpfung an die Durchführungen in den letzten zwei Jahren werden im Minisymposium die folgenden Fragen fokussiert und vertieft, die verschiedene Facetten der Gestaltung und des Einsatzes formativer digitaler Assessments in Schule und Hochschule adressieren:
Welche Diagnoseaufgaben sind geeignet? Wie sind formative Assessments gestaltet und wie lassen sie sich auswerten? Welche (technologiebasierten) Designs sind geeignet und wie können diese implementiert werden? Wie gestalten sich Wahrnehmung und Akzeptanz durch Lernende und Lehrende?
Leitung: Frank Feudel (Berlin), Erik Hanke (Schwäbisch Gmünd)
Mathematiklehrkräfte benötigen umfangreiche fachliche Kompetenzen für die Gestaltung von lernförderlichem Mathematikunterricht. Neben der unmittelbaren Versiertheit mit den schulmathematischen Inhalten sollten sie diese natürlich auch von einem höheren Standpunkt durchdringen, um fachliche Reduktionen auf ihre intellektuelle Redlichkeit oder Verzerrung hin untersuchen oder auf heterogene Fragen und Antworten von Schülerinnen und Schülern fachlich flexibel eingehen zu können. Außerdem sollten angehende Mathematiklehrkräfte in ihrer universitären Ausbildung auch prozessbezogene Kompetenzen wie mathematisches Argumentieren, Problemlösen oder mathematisches Modellieren erwerben, um diese später in ihrem eigenen Unterricht, wie in den Bildungsstandards vorgesehen, fördern zu können. Daher ist es seit vielen Jahren ein wichtiger Gegenstand fachdidaktischer Forschung, wie universitäre Lehrveranstaltungen die benötigten Fachkompetenzen von Lehramtsstudierenden fördern können.
Die gegenwärtige Fachausbildung zukünftiger Mathematiklehrkräfte steht jedoch häufig in der Kritik. Zum einen knüpfe die Mathematik an der Hochschule kaum an den aus der Schule bekannten Diskurs an und werde oft vom Inhalt her zu wenig mit dem Schulstoff relationiert („doppelte Diskontinuität“), weshalb Studierende dort kaum für ihren späteren Beruf passende inhaltsspezifische fachliche Kompetenzen erwürben. Zum anderen würden in traditionellen Fachveranstaltungen für Lehramtsstudierende mathematische Prozesse selten zu einem expliziten Lerngegenstand gemacht.
In diesem Mini-Symposium soll daher der Erwerb von inhaltsspezifischen und prozessbezogenen fachlichen Kompetenzen im Lehramtsstudium Mathematik genauer beleuchtet werden. Dies soll zum einen Beiträge umfassen, die die momentan im Lehramtsstudium vermittelten und erworbenen inhalts- und prozessbezogenen mathematischen Kompetenzen (kritisch) analysieren. Andererseits sollen auch Möglichkeiten zur bewussten Förderung von für Mathematiklehrkräften relevanten fachlichen Kompetenzen im Studium vorgestellt werden. Hierbei sind verschiedene theoretische Perspektiven und forschungsmethodische Ansätze denkbar: fachliche und stoffdidaktische Analysen sowie kognitiv-konstruktivistische, institutionelle oder soziokulturelle Perspektiven. Dementsprechend begrüßen wir eine Vielfalt der Forschungsansätze. Wir würden auch gerne möglichst verschiedene Lehramtsstudiengänge in den Blick nehmen, um Gemeinsamkeiten in Bezug auf die vermittelten und erworbenen fachlichen Kompetenzen, aber auch Spezifika bei einzelnen Studiengängen, sichtbar zu machen.
Leitung: Julia Bruns (Paderborn), Miriam Lüken (Bielefeld), Stephanie Schuler (Kaiserslautern-Landau)
Das Minisymposium Frühe mathematische Bildung befasst sich mit den Grundlagen des Mathematiklernens im Elementarbereich. Ziel ist der Austausch und die Diskussion aktueller Forschung zur mathematischen Entwicklung der 0- bis 7-Jährigen und zur Gestaltung des mathematischen Lernens inklusive des theoretischen und methodologischen Rahmens. Wir begrüßen Beiträge, die über Studien aus den Perspektiven der verschiedenen Akteure berichten. Aus Kindperspektive nehmen wir fachdidaktisch-entwicklungspsychologisch orientierte Forschung zur Entwicklung des Wissens und Denkens bezogen auf die mathematischen Inhaltsbereiche sowie die prozessbezogenen Kompetenzen in den Blick. Aus der Perspektive der frühpädagogischen Fachkraft sollen Aus- und Fortbildungskonzepte sowie die Bedeutung professioneller Kompetenzen der frühpädagogischen Fachkräfte im Hinblick auf das Mathematiklernen der Kinder diskutiert werden. Der dritte thematische Schwerpunkt beleuchtet das Zusammenspiel zwischen den unterschiedlichen Akteuren und Sozialisationsinstanzen im Kontext der frühen mathematischen Bildung. Wir freuen uns über Beiträge aus dem gesamten oben genannten Spektrum, die unser Verständnis von Fragen des frühen mathematischen Lernens vertiefen.
Leitung: Flavio Angeloni (Hannover), Christian Hausch (Klagenfurt), Swetlana Nordheimer (Berlin)
Gebärdensprachen sind eigenständige Sprachen, unterscheiden sich grundlegend von Lautsprachen und weisen Eigenschaften auf, die Einfluss auf das Lehren und Lernen von Mathematik haben können. Im deutschsprachigen Raum ist die mathematikdidaktische Forschung über und mit Gebärdensprachen ein noch junger Bereich. Die Auseinandersetzung mit Gebärdensprachen in der Mathematikdidaktik gilt nicht nur als wichtiger Beitrag zur Inklusion gebärdensprachorientierter Menschen in Schule und Gesellschaft, sondern bietet für klassische fachdidaktische Fragestellungen etwa im Zusammenhang mit der Entwicklung von Lernumgebungen für Raumgeometrie neue wissenschaftliche Perspektiven, Forschungsmethoden und Einsichten.
Das Minisymposium setzt sich das Ziel, dem mathematikdidaktischen Diskurs in Gebärdensprachen einen Beitrag zu leisten. Es soll daher Raum für theoretische und empirische Forschungsbeiträge geboten werden, die von den Potenzialen der Gebärdensprachen ausgehen. Die Verbindung von Forschung und Praxis soll als integrierender Bestandteil dieses Diskurses gefördert werden, sodass Entwicklungsarbeiten und Berichte aus der Praxis des Mathematikunterrichts mit und in Gebärdensprachen, zum Beispiel aus der bimodal-bilingualen Praxis, diskutiert werden sollen. Um die Besonderheiten der mehrdimensionalen gestisch-visuellen Modalität der Gebärdensprachen effizient zu nutzen, soll der Einsatz digitaler Medien reflektiert werden. Gebärdensprachen, ebenso wie Lautsprachen, verstehen sich im Minisymposium als Sprachen des wissenschaftlichen Austausches.
Leitung: Dinah Reuter (Freiburg), Jessica Hoth (Rostock), Silke Ruwisch (Lüneburg)
Vorstellungen zu Größen entwickeln sich bei Kindern bereits vor Schuleintritt und sind für den Alltag von hoher Relevanz. Der Mathematikunterricht hat daher den Auftrag, die Entwicklung des Größenverständnisses systematisch zu begleiten und dadurch einen adäquaten Aufbau zu unterstützen. Trotz hoher Relevanz liegen bisher verhältnismäßig wenig Forschungsbefunde vor, die sich darüber hinaus häufig auch mit Blick auf Begrifflichkeiten und Konzeptualisierungsvorschläge unterscheiden.
Das geplante Symposium knüpft an die Minisymposien der Jahre 2020, 2021 und 2023 an und möchte unser aller Wissen um die Entwicklung des Größenverständnisses erweitern und den Diskurs fortsetzen. Die thematische Auseinandersetzung erfolgt dabei aus verschiedenen Perspektiven: Im Fokus stehen individuelle Lernvoraussetzungen, institutionelle Rahmenbedingungen, professionsbezogene Merkmale auf Seiten der Lehrkräfte sowie unterrichtsbezogene Einflussfaktoren.
Das Symposium soll zum Austausch zwischen Forschungsprojekten beitragen, vorhandene Befunde mit Blick auf Begrifflichkeiten und Konzeptualisierungen systematisieren, Desiderate identifizieren und die Entwicklung gemeinsamer Forschungsperspektiven vorantreiben.
Leitung: Charlott Thomas (Potsdam), Maria Wendt (Dresden), Antonia Wunsch (Hildesheim)
Bereits vor Schuleintritt setzen sich Kinder mit stochastischen Phänomenen auseinander. Dieses Vorwissen bietet Potenzial, das im Grundschulunterricht aufgegriffen und systematisch weiterentwickelt werden sollte, um eine tragfähige Grundlage für die Bearbeitung stochastischer Themen in der Sekundarstufe zu schaffen. Dabei sind Kombinatorik und Wahrscheinlichkeit eng miteinander verknüpft: Das Bestimmen von Kombinationsmöglichkeiten kann dabei einen Zugang zu probabilistischem Denken eröffnen. Allerdings verdeutlichen empirische Befunde, dass Lernende erhebliche Schwierigkeiten beim Lösen kombinatorischer Aufgaben haben (u. a. Herzog et al., 2017), die – ebenso wie in der Wahrscheinlichkeit – häufig auf ein mangelndes konzeptuelles Verständnis zurückzuführen sind (u. a. Martignon, 2014). Vor diesem Hintergrund besteht Forschungsbedarf sowohl hinsichtlich geeigneter didaktischer Materialien und personaler Einflussfaktoren als auch im Hinblick auf deren Vernetzung. Das Minisymposium widmet sich diesen Fragestellungen und zielt darauf, Perspektiven aus verschiedenen Bildungsstufen und Kontexten zusammenzuführen, um eine Verzahnung von Forschung und Praxis zu unterstützen.
Literatur
Herzog, M., Ehlert, A., & Fritz, A. (2017). Kombinatorikaufgaben in der dritten Grundschulklasse: Darstellung, Abstraktionsgrad und Strategieeinsatz als Einflussfaktoren auf die Lösungsgüte. Journal für Mathematik-Didaktik, 38(2), 263–289.
Martignon, L. (2014). Fostering children’s probabilistic reasoning and first elements of risk evaluation. In E. J. Chernoff & B. Sriraman (Eds.), Probabilistic thinking: Presenting plural perspectives (pp. 149–160). Springer.
Leitung: Ángela Uribe (St. Gallen), Rebecca Klose (Gießen)
Mehrsprachigkeit ist in den meisten Klassen des deutschsprachigen Raums prä- sent. Sie zeigt sich deutlich in bilingualen Settings, tritt aber auch dann hervor, wenn Kinder mehrere Sprachen in ihrem Repertoire haben. Ein sprachbildender und verstehensorientierter Mathematikunterricht kann von dieser sprachlichen Vielfalt profitieren. Die zentrale Frage ist, wie Mehrsprachigkeit im Unterricht gezielt für das mathematische Lernen nutzbar gemacht werden kann.
Das Minisymposium greift diese Fragestellung auf. Im Mittelpunkt stehen For- schungsergebnisse zu sprachlichen und fachlichen Lernprozessen unter mehrsprachigen Bedingungen sowie Praxisansätze und Initiativen in der Aus- und Weiterbildung, die Lehrpersonen darin unterstützen, Mehrsprachigkeit produktiv einzubeziehen.
Wir laden Interessierte ein, einen Beitrag einzureichen. Eingereicht werden können empirische Studien, theoretische Arbeiten, Praxisbeispiele und Projektideen, auch wenn sie sich noch in einem frühen Stadium befinden.
Leitung: Melanie Platz (Saarbrücken), Aileen Steffen- Delplanque (Osnabrück)
nsbesondere seit den 2016 angestoßenen bildungspolitischen Entwicklungen, wie die ‚Strategie: Bildung in der digitalen Welt’ (KMK 2016), erfährt die Digitalisierung des Bildungsbereiches auch in der Mathematikdidaktik eine stärkere Aufmerksamkeit. 2021 ergänzte die KMK die Strategie mit der Empfehlung ‚Lehren und Lernen in der digitalen Welt‘, wonach die Berücksichtigung veränderter Bedingungen des Lehrens und Lernens im Kontext digitalen Wandels Aufgabe aller Fächer sei. Auf dieser Basis nehmen die Bildungsstandards für das Fach Mathematik – Primarbereich (KMK, 2022) – diese Anforderung auf, indem Strukturmodelle und Standardformulierungen mit Blick auf die domänenspezifischen Erwartungen an den Kompetenzerwerb in der digitalen Welt weiterentwickelt wurden.
Um diesen Entwicklungen Rechnung zu tragen, ist es das Ziel des Minisymposiums, aktuelle Forschungs- und Entwicklungsarbeiten zum Einsatz digitaler Medien im Mathematikunterricht der Primarstufe und in der frühkindlichen Bildung sowie Möglichkeiten für die Aus- und Fortbildung von Mathematiklehrkräften zu präsentieren und zu diskutieren. Gemäß des ‚Primats der Fachdidaktik’ erfolgt eine Auseinandersetzung mit Forschungsprojekten und Lehr- und Lernangeboten, die sich an den technischen Gegebenheiten und daraus resultierenden fachdidaktischen Potentialen orientieren.
Leitung: Malina Abraham (Dortmund), Sofia Bielinski (Dortmund), Hoang Nguyen (Münster)
Digitale Medien wie z. B. digitale Mathematikwerkzeuge, dynamische Visualisierungen oder Erklärvideos bieten Potenziale, Lehr- und Lernprozesse im Mathematikunterricht produktiv zu unterstützen.
Potenziale wurden bereits für verschiedene digitale Medien für unterschiedliche Lerngegenstände empirisch nachgewiesen. Allerdings zeigt sich auch, dass in der Unterrichtspraxis diese Potenziale häufig nicht ausgeschöpft werden. Noch relativ unerforscht sind dabei Designelemente, die die konkrete Einbindung digitaler Medien in den Mathematikunterricht leiten, sodass Lehr- und Lernprozesse produktiv unterstützt werden. Eine Orientierung können die Designprinzipien Verstehensorientierung, kognitive Aktivierung, Kommunikationsförderung und Lernendenorientierung & Adaptivität (Prediger et al. 2022) bieten, anhand derer Designelemente ausdifferenziert werden können.
In diesem Minisymposium sollen daher empirische Forschungsbeiträge diskutiert werden, die die Einbindung digitaler Medien unter Berücksichtigung von zentralen Prinzipien für qualitätsvollen Mathematikunterricht wie z. B. (dynamische) Darstellungsvernetzung oder Sprachaufbau im Sinne der Verstehensorientierung fokussieren.
Beispiele für mögliche Schwerpunktsetzungen könnten sein:
- Interventionsstudien zur Lernwirksamkeit von digitalen Medien, die zentrale Prinzipien für qualitätsvollen Mathematikunterricht berücksichtigen
- Design-Research-Studien zum Einsatz digitaler Medien
- Qualitative empirische Einblicke in die Nutzung von digitalen Medien
- ...
Leitung: Dilan Şahin-Gür (Dortmund), Victoria Shure (Münster), Anke Lindmeier (Erlangen-Nürnberg)
Der Begriff der Professionalisierung nimmt im Rahmen der Mathematiklehrkräftebildung eine zentrale Stellung ein. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie sich professionelle Kompetenzen bzw. Expertise von Lehrkräften theoretisch rahmen, empirisch untersuchen und durch gezielte Lerngelegenheiten fördern lassen. Professionalisierung bezeichnet nach Baumert & Kunter (2013) einen Prozess der Entwicklung von Wissensbeständen, motivationalen Orientierungen und Handlungskompetenzen, die spezifisch für professionelles Handeln in pädagogischen Kontexten erforderlich sind. Lehrkräfte sollen befähigt werden, berufliche Anforderungen zu bewältigen. Zielsetzungen der Professionalisierungsprozesse sind in Kompetenzmodellen, etwa von Baumert & Kunter (2013), dem erweiterten Modell professioneller Kompetenz nach Blömeke et al. (2015) oder dem AC/RC-(Action-related Competence/Reflection-related Competence-)Kompetenzmodell (Lindmeier, 2011) konzeptualisiert und in der Mathematikdidaktik breit rezipiert. Weniger Aufmerksamkeit haben bisher jedoch Professionsentwicklungsmodelle erhalten. Häufig wird das Kontinuum von Blömeke et al. (2015) im Sinne eines linearen individuellen Entwicklungsmodells gelesen, während z.B. das Interconnected Model of Professional Growth von Clark & Hollingsworth (2002), einen dynamischeren, nicht-linearen Zugang bietet. Es existieren verschiedene Ansätze zur Beschreibung professioneller Entwicklung, etwa als soziales (Borko, 2010), reflexives (Clark & Hollingsworth, 2002) oder situiertes gegenstandsbezogenes Lernen (Prediger, 2019). Obwohl Professionalisierungsmaßnahmen auf unterschiedlichen theoretischen Annahmen beruhen, wird bislang wenig systematisch reflektiert, welche (expliziten oder implizit angenommenen) Professions-Entwicklungsmodelle ihnen zugrunde liegen. Das wäre jedoch für eine kumulative Erkenntnisgewinnung und Vergleichbarkeit innerhalb der Professionalisierungsforschung wichtig.
Ziel des Symposiums ist es, in den Dialog über unterschiedliche Professionsentwicklungsmodelle zu treten und diese hinsichtlich ihrer theoretischen Grundlagen, empirischen Befunde und konzeptionellen Anschlussstellen zu diskutieren. Dazu sollen konkrete Lerngelegenheiten in der ersten und zweiten Phase der Lehrkräftebildung betrachtet werden, v.a. mit Blick auf ihre theoretische Grundlegung, angenommenen (bzw. nachgewiesene) Wirksamkeit und die zugrundeliegenden Kompetenzmodelle. Der Diskurs kann auch auf Multiplizierende (z.B. Fortbildende, Fachleitungen) erweitert werden, z.B. im Hinblick auf vergleichbare Zielsetzungen und Entwicklungsprozesse.
Das Mini-Symposium lädt Beiträge ein, die sich mit Professionalisierungsmaßnahmen von (angehenden) Mathematiklehrkräften befassen, insbesondere mit Blick auf folgende Themen:
- Lehr-Lern-Theorien und deren Anwendung bei der Gestaltung von Lerngelegenheiten
- (Evidenzbasierte) Designprinzipien für lernwirksame Lerngelegenheiten
- Theoretische Modellierungen von Ziel-Konstrukten und zugehörigen Entwicklungsmodellen
Leitung: Henning Sievert (Hildesheim), Sebastian Rezat (Paderborn), Aiso Heinze (Kiel)
Mathematikschulbücher sind auch in Zeiten der Digitalisierung die zentralen Ressourcen für das Lehren und Lernen von Mathematik. Sie haben maßgeblichen Einfluss auf die Wahrnehmung des Faches, auf die Lerngelegenheiten und auf den Kompetenzerwerb. Damit beeinflusst keine Ressource das Lehren und Lernen von Mathematik so nachhaltig wie das Schulbuch. Gleichzeitig ist das Schulbuch ein Mikrokosmos, in dem vielfältige Ansätze und Gegenstände mathematikdidaktischer Forschung zusammentreffen. Diese vielfältige Forschung zu analogen und digitalen Mathematikschulbüchern sowie anderen curricularen Ressourcen, die vor dem Hintergrund eines Lehrplans eine strukturierte Sequenz von Lerngelegenheiten anbieten, wird im Minisymposium gebündelt. Insbesondere stehen folgende Aspekte im Vordergrund:
- Die Rolle, der Stellenwert von Mathematikschulbüchern in allen Schulstufen und -formen sowie im Rahmen der Governance des Bildungssystems.
- Analysen inhaltlicher und gestalterischer Aspekte von Mathematikschulbüchern.
- Empirisch evaluierte Aspekte der Entwicklung und des Designs von Mathematikschulbüchern.
- Aspekte der Nutzung von Mathematikschulbüchern durch Lehrkräfte, Lernende und weitere Akteure (Eltern, Nachhilfelehrkräfte, …).
- Aspekte der Wirkung von Mathematikschulbüchern auf den Unterricht, Lehrkräfte und Lernende.
- Forschungsmethodische Aspekte der Schulbuchforschung.
Leitung: Susanne Digel (Landau) Gilbert Greefrath (Münster), Lena Wessel (Paderborn)
Dieses Mini-Symposium untersucht die Bedeutung von Vorstellungen im Mathematikunterricht der Sekundarstufe II, mit besonderem Schwerpunkt auf der linearen Algebra/Analytischen Geometrie, Analysis und Stochastik. Die Beiträge beleuchten, wie Vorstellungen und Verstehen der Inhalte erworben werden können. Dabei spielen auch die Durchgängigkeit und Vernetzung von Lehr- und Lerninhalten, die Sprache, Einsatz von Technologie sowie die Förderung allgemeiner Kompetenzen eine wichtige Rolle. Es soll eine Diskussion bestehender unterrichtlicher Ansätze, curricularer Anforderungen, Aufgabengestaltung in Unterricht und Prüfung sowie empirischer Studien angeregt werden. Die praktische Umsetzung dieser Strategien und ihr Einfluss auf die Lernprozesse und Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler werden ebenfalls diskutiert.
Das Minisymposium gibt einen Überblick über aktuelle Herausforderungen und Chancen in der Mathematikdidaktik der Sekundarstufe II und formuliert Empfehlungen für eine zukunftsorientierte Gestaltung des Unterrichts. Abschließend werden Implikationen für Curricula, Prüfungen und Lehrkräftefortbildung diskutiert, die darauf abzielen, Vorstellungsaufbau wirksamer und nachhaltig im Mathematikunterricht zu realisieren.
Leitung: Melina Fabian (Potsdam), Olga Lomas (Paderborn), Jessica Mähnert (Halle, Saale)
Im Zusammenhang mit der Begriffsbildung und dem Vorstellungsaufbau für mathematische Konzepte sowie der Förderung kommunikativer Kompetenzen spielt Sprache eine zentrale Rolle. Sie ist sowohl Medium der Wissensvermittlung im Unterricht (kommunikative Funktion) als auch der individuellen Wissenskonstruktion für Lernende (kognitive Funktion). Die Idee eines sprachbildenden Mathematikunterrichts ist, diesen Zusammenhang zwischen Sprache und Denken produktiv für Lehr-Lern-Prozesse nutzbar zu machen. In der mathematikdidaktischen Forschung geraten neben der sprachlichen Unterstützung bei der Aneignung mathematischer Konzepte zunehmend auch diskursive Praktiken (etwa das Erklären, Begründen und Argumentieren) in den Blick. In diesem Minisymposium sollen daher aktuelle Forschungs- und Entwicklungsarbeiten vorgestellt und diskutiert werden, in denen fachliches und sprachliches Lernen ‚zusammengedacht‘ wird. Die Überlegungen können dabei gegenstandsspezifisch oder konzeptioneller Natur sein, sich auf verschiedene Alters- und Klassenstufen beziehen sowie unterschiedliche Ebenen des Lernens und Lehrens von Mathematik – wie z. B. die Analyse individueller Lernprozesse, die Unterrichtsplanung und -interaktion oder Professionalisierung von Lehrkräften – adressieren.
Das Minisymposium soll Raum für inhaltlichen Dialog zu spannenden Forschungsansätzen und -projekten bieten und richtet sich hierfür auch explizit an den wissenschaftlichen Nachwuchs. Die Vielfalt der möglichen, mit dem Thema verbundenen Fragestellungen kann und soll sich auch in einer Vielfalt der Forschungszugänge widerspiegeln – willkommen sind daher sowohl qualitative als auch quantitative Ansätze sowie theoretische Arbeiten.
Leitung: Lukas M. Günther (Hannover), Felix Lensing (Berlin), Kata Sebök (Wien), Jana Peters (Paderborn)
Mathematikdidaktische Forschung und Praxis entwerfen und nutzen Theorien über unterschiedliche Aspekte des Lehrens und Lernens von Mathematik und unterziehen diese einer kritischen Prüfung. Im Minisymposium laden wir zu einer gemeinsamen Reflexion über die vielfältigen Theorien und deren Funktionen in mathematikdidaktischer Forschung und Praxis ein:
- Welche Formen können die Bildung, Verwendung und Prüfung von Theorie in mathematikdidaktischer Forschung und Praxis annehmen?
- Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede bestehen in der Theoriebildung, -prüfung und -reflexion in mathematikdidaktischer Forschung und Praxis?
- Wie beeinflussen verschiedene Eigenschaften und (Selbst-)Konzeptualisierungen des forschenden Subjekts Prozesse der Bildung, Verwendung und Prüfung von Theorie in mathematikdidaktischer Forschung und Praxis?
- …
Willkommen sind sowohl Beiträge, welche eine oder mehrere dieser Leitfragen explizit ins Zentrum stellen, als auch solche, die die Rolle einer Theorie in einem konkreten mathematikdidaktischen Forschungsprojekt reflektieren.
Leitung: Hannes Eirund (Hildesheim), Martin Ohrndorf (Bremen), David Schwarzkopf (Bamberg)
Erklärvideos gewinnen im Kontext des Lehrens und Lernen von Mathematik zunehmend an Bedeutung. Dies gilt sowohl für formale (z. B. Schule, Hochschule) als auch für informelle (z. B. YouTube) Bildungsangebote (z. B. MPFS, 2024). Ihre Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig (Wolf & Kulgemeyer, 2016): Sie lassen sich in allen Inhaltsbereichen der Mathematik und in unterschiedlichen didaktischen Settings nutzen. So können sie beispielsweise zur Motivation beitragen, die traditionelle Unterrichtsstruktur im Sinne des Flipped-Classroom-Modells flexibilisieren oder von Lernenden selbst erstellt werden.
Trotz ihrer möglichen Potenziale ist der Einsatz von Videos auch mit Herausforderungen verbunden. Dazu zählen insbesondere die teils große Qualitätsheterogenität des frei verfügbaren Angebots sowie deren vorwiegend passiv-rezeptiver Charakter (Klinger & Walter, 2022). Um diesen Herausforderungen zu begegnen, können (fach-)didaktische Qualitätskriterien bei der Erstellung von Erklärvideos berücksichtigt oder diese durch kognitiv aktivierende Aufgaben innerhalb einer Lernumgebung ergänzt werden.
Ziel des Minisymposiums ist der Austausch und die Diskussion aktueller Forschung zum Lehren und Lernen von Mathematik unter besonderer Berücksichtigung des Einsatzes von Erklärvideos. Potenzielle Beiträge können unter anderem die folgenden Themen adressieren:
- Systematische Literaturanalysen zum aktuellen Forschungsstand
- Untersuchungen zur Wahrnehmung und Nutzung von Erklärvideos durch Lehrende oder Lernende
- Studien zu Gelingensbedingungen eines lernförderlichen Videoeinsatzes im Mathematikunterricht (z. B. Qualitätskriterien, Einbettung in eine Lernumgebung, interaktive Elemente)
- Forschung zur Evaluation (digitaler) Lernumgebungen mit besonderem Fokus auf dem Einsatz von Erklärvideos
Leitung: Jens Krummenauer (Esslingen), Michael Fischer (Graz)
Eine der zentralen Herausforderungen in der Aus- und Fortbildung von Lehrkräften ist die Verknüpfung von Theorieelementen und praktischem Handeln. In diesem Kontext sind Vignetten in verschiedensten Anwendungen der Lehrkräftebildung und der fachdidaktischen Forschung etabliert, um Aspekte der beruflichen Praxis von Lehrkräften in einen reflexiven, vom Handlungsdruck entlasteten Raum zu transferieren – etwa das Mathematisieren einer Realsituation beim Modellieren oder Aspekte von Unterrichtssituationen, in denen Lernende Argumente entwickeln. Es hat sich allerdings immer wieder gezeigt, dass zahlreiche Aspekte beim Design von Vignetten berücksichtigt werden müssen, wenn diese als präzise Werkzeuge für Forschung und Lehre eingesetzt werden sollen. In diesem Minisymposium soll reflektiert werden, wie Vignetten für verschiedene Anwendungskontexte zielgerichtet als Werkzeug konstruiert werden können, welche Erfahrungen hinsichtlich bestimmter Gestaltungsmerkmale vorliegen und welche neuen Anwendungsfelder durch bestimmte Designs erschlossen werden können.

In den Minisymposien wird ein eingegrenztes, aktuelles Forschungsthema der Mathematikdidaktik von verschiedenen Sichtweisen beleuchtet. Über die Annahme eines Minisymposiums entscheidet das aktuelle Programmkomitee. Die Vorträge innerhalb eines Minisymposiums durchlaufen ein systematisches Qualitätssicherungsverfahren durch die Leitung der Minisymposien. Im Folgenden wird der Ablauf genauer beschrieben. Alle gesammelten Informationen finden Sie zudem hier.
Beachten Sie bitte, dass sie nur die von uns zur Verfügung gestellten Formatvorlagen nutzen. Aufgrund eines neuen Barrierefreiheitstärkungsgesetzes müssen die Beiträge bestimmte Vorgaben erfüllen, die in den Formatvorlagen erläutert und umgesetzt werden. Weitere Informationen unter: https://www.wtm-verlag.de/barrierefreiheit/
Vorlagen zum Download
Ablauf der Einreichung
01.06.2025 bis 01.09.2025: Einreichung von Vorschlägen für ein Minisymposium
Füllen Sie dazu zunächst die Dokumentenvorlage „Minisymposium Onepager“ aus und geben Sie dem Dokument den Dateinamen “GDM2026_MS_Thema“ (Ergänzen Sie hier bitte das von Ihnen gewählte Thema bzw. den gewählten Titel). Senden Sie das Dokument mit dem Betreff „Einreichung Minisymposium“ vor Ende der Frist per E-Mail an gdm2026[at]uni-wuppertal.de und machen Sie in der Mail bitte einen Vermerk zu der Zeitstruktur. Wir empfehlen pro Beitrag 45 min. (inkl. Diskussion & 10 min Wechselpause).
Ab 01.10.2025: Bekanntgabe angenommener Minisymposien durchs Programmkomitee
Ab diesem Zeitpunkt ist auch die Anmeldung zur Tagung sowie die Einreichung eines Beitrags für ein Minisymposium (inkl. vierseitigem Tagungsbandbeitrag) via ConfTool möglich.
01.12.2025: Ende der Frist zur Einreichung eines Beitrags
Ab 19.12.2025: Information über Annahme bzw. Ablehnung des Beitrags
09.01.2026: Ende der Frist zum Hochladen von Änderungen an den Beiträgen
Die Leitung des Minisymposiums verfasst im Anschluss an die Tagung für die “Beiträge zum Mathematikunterricht” eine zweiseitige Einleitung zum Minisymposium und lädt diese bis zum 05.04.2026 in ConfTool hoch.
Weiter Fristen und Termine finden Sie hier.
Verantwortliche
Ein Minisymposium kann durch 2-3 Personen der Community eingereicht werden. Kriterium ist dabei, dass mindestens zwei der beteiligten Personen von verschiedenen Hochschulstandorten kommen.